Wassergüte der Donau 2008-2009
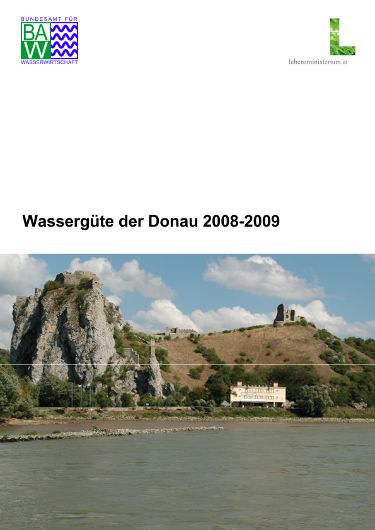
Im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie der Landesregierungen von Oberösterreich und Niederösterreich und des Magistrats der Stadt Wien wurden die Donau und ihre Zubringer im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Wasserrechtsgesetz, Gewässerzustandsüberwachungsverordnung, Donauschutzübereinkommen) sowie im Rahmen zwischenstaatlicher Vereinbarungen (Regensburger Vertrag, Österreichisch-Slowakische Grenzgewässerkommission) oder multilateraler Übereinkommen (Transnational Monitoring Network der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau) auch im Jahr 2008-2009 regelmäßig untersucht.
Die vorliegende Publikation umfaßt eine Aufbereitung der im Berichtszeitraum vom Institut für Wassergüte sowie den Ämtern der Landesregierungen von Oberösterreich, Niederösterreich und Wien gesammelten chemischen Meßdaten der Donau und den mündungsnächsten Meßstellen der Zubringer, eine Diskussion und Interpretation der wichtigsten Daten sowie Grafiken und tabellarische Zusammenstellungen zur Illustration der Ergebnisse.
- Herausgeber:
- Bundesamt für Wasserwirtschat - Institut für Wassergüte
- Ausgabejahr:
- 2010
- Ausgabeort:
- Wien
- Kategorie:
- Wassergüte
- Seitenanzahl:
- 138