Natürliche und künstliche Seen Österreichs größer als 50 Hektar, Stand 2009
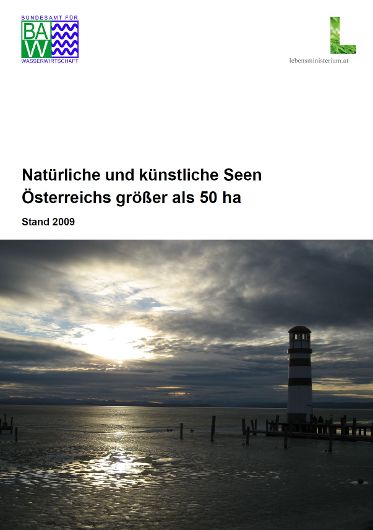
In Erweiterung des „Atlas der natürlichen Seen Österreichs mit einer Fläche größer als 50 Hektar - Stand 2005“ - er beschreibt 43 Seen - umfasst die vorliegende Ausgabe „Natürliche und Künstliche Seen Österreichs größer als 50 Hektar – Stand 2009“ auch noch die künstlichen stehenden Gewässer entsprechender Größe. Die Gewässer werden, wie schon in der vorangegangenen Zusammenstellung, in 6 Typregionen und 11 Seentypen eingeteilt.
Gesondert ausgewiesen sind Seen des Interkalibrierungsmessnetzes gemäß EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie 2000), nationale Referenzmessstellen und Überblicksmessstellen des Seenmonitorings gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV 2006). Einleitend wird jeder See aufgrund seiner geografischen und topografischen Besonderheiten und gemäß der Gegebenheiten seines Umlands beschrieben.
Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der abiotischen und biologischen Kenngrößen. Neben physikalischen, limnochemischen und hydromorphologischen Informationen finden sich auch Angaben zu den biologischen Qualitätskomponenten und zum trophischen Grundzustand. Ergänzend beschreiben Daten aus dem CORINE-Landcover Directory (2009) die anthropologischen Belastungen im Seeneinzugsgebiet und die Nutzungen des Gewässers – über detaillierte Informationen dazu verfügt das Institut für Wassergüte.
- Herausgeber:
- Bundesamt für Wasserwirtschaft
- Ausgabejahr:
- 2010
- Ausgabeort:
- Wien
- Format:
- Download
- Kategorie:
- Wassergüte
- Seitenanzahl:
- 200 (von 425)